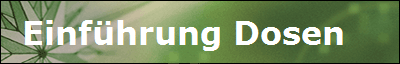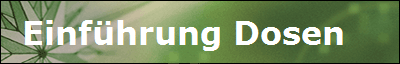|
Zuckerdosen und Zuckerschalen
(meist als Fußschalen) waren von Anfang an im Pre ßglasprogramm. Bei Baccarat und St. Louis sind sie Teile von Servicen, auch wenn sie im Katalog schon einmal auf einer eigenen Seite (MB Launay, ca 1840, planche 26)
zusammengefaßt werden. Sie sind bauchig und rund oder oval, ähneln noch ihren geblasenen Vorgängerinnen. Bei den Zuckergefäßen werden beide Hütten auch in Zukunft die klassische Formensprache weitgehend beibehalten. ßglasprogramm. Bei Baccarat und St. Louis sind sie Teile von Servicen, auch wenn sie im Katalog schon einmal auf einer eigenen Seite (MB Launay, ca 1840, planche 26)
zusammengefaßt werden. Sie sind bauchig und rund oder oval, ähneln noch ihren geblasenen Vorgängerinnen. Bei den Zuckergefäßen werden beide Hütten auch in Zukunft die klassische Formensprache weitgehend beibehalten.
Das nun ist die Stunde von Vallérysthal. Ich
glaube, keine der europäischen Glashütten hat seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ein ähnlich großes Sortiment und eine ähnliche Formenvielfalt bei Zuckerdosen entwickelt wie
Vallérysthal und Portieux. (Auch Val St. Lambert bot im Katalog von 1913 auf 3 Seiten 76 Zuckerdosen – mit Varianten 102 - an. Zumeist
sind es jedoch die herkömmlichen Formen – Kugelform, mit oder ohne Fuß, hoher oder niedriger Stiel, und mindestens eine – planche 94, Nr. 24; meine Slg. 4.030 – ist die Kopie einer V & P
Zuckerdose). Bei den Zuckerdosen von Vallérysthal zeigt sich, was die Technik des Pressens tatsächlich leisten kann im Vergleich zur Arbeit des Glasbläsers. Formen und Dekore vieler
Kunstepochen und anderer kunsthandwerklicher Bereiche lieferten die Vorlagen. Das Material Glas wurde undurchsichtig und ähnelte nun Porzellan oder Keramik. Die Kastenform wurde von
den Silberschmieden (oder von den Töpfern) übernommen. Mit den Früchten und dem Kohlkopf griff man auf Vorbilder aus der Töpferkunst zurück. Wie Porzellan oder Fayencen wurden die
Stücke "vergoldet" bzw. bunt bemalt. Für einzelne Dosen gab es bis zu 6 unterschiedliche farbige Dekore. Die vollplastischen Elemente (Hunde, Vögel, Eichhörnchen, Hühner usw.) sind
naturalistisch und äußerst präzise modelliert. "Klassische" Ornamente wie Akanthusblatt, Rocaillen oder Voluten werden ebenso verwendet wie "naturalistische": Kirschen, Blätter,
Zweige. Einige der Dosen sind in Form und Dekor vom Jugendstil beeinflußt.
Am erstaunlichsten scheint mir, daß die meisten dieser Objekte beinahe ein halbes Jahrhundert
im Programm waren, wie ein Vergleich der Portieux
Musterbücher von 1894 und 1933 zeigt.
Das hängt sicherlich auch mit der Entwicklung der Zuckerindustrie zusammen, mit der
Verbilligung des ehemaligen Luxusgutes, das nun nicht mehr aus den Kolonien herangeschafft werden mußte, mit hohen Zöllen belegt wurde, sondern in großen Mengen überall in Europa
produziert wurde. Die folgenden Zahlen entnahm ich einer der Schriften des "Zuckermuseums" in Berlin, um zu demonstrieren wie der Zucker im Verlauf des 19. Jahrhunderts vom Luxusgut, das
in silbernen und abschließbaren Zuckerdosen aufbewahrt wurde, zum Nahrungsmittel wurde: Um 1850, als sich in Europa der Rübenzucker gegen den Rohrzucker endgültig durchgesetzt hatte,
kosteten im Großhandel 100 kg Rohzucker 59,10 Mark, 1900 nur noch 19,44 Mark. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Europa lag um 1850 bei 2 kg, 1895 bei 11 und 1913 bei 20 kg jährlich.
Viele der in Vallérysthal und Portieux entwickelten und produzierten Zuckergefäße sind in alle
Welt – und das kann man wörtlich verstehen – exportiert worden. Wie sonst gäbe es diese vielen Sammlungen in den USA von "milk glass" (siehe das schöne Buch von Chiarenza und Slater) und wie sonst könnte man immer mal wieder alte Zuckerdosen "marked Vallérysthal" über eBay aus Hongkong erstehen.
Nicht ganz so reichhaltig, aber nicht minder phantasievoll ist das Programm der beiden Hütten bei "
beurriers" (s. MB Portieux 1933, planche 327, mit "Éléphant 6710", "Tortue 6711", "Chou 6719", "Cygne 6722").
Die Hennendosen und die
Garnitures de toilette hätten eigentlich je ein eigenes Kapitel verdient gehabt und wären einer ausführlicheren Betrachtung wert gewesen – aber "oh, Zeit, Kraft, Bargeld und Geduld" ...
Zur ersten Seite mit Dosen hier entlang.
|
|